
In den letzten Monaten und Jahren wurden zahlreiche Gesetze verabschiedet, die konkrete Auswirkungen auf das Wohnen haben. Lediglich eins ist klar: Die Wohnnebenkosten, vor allem die Energiepreis, steigen für die meisten Verbraucher. So gibt es für Eigentümer sowie Verwalter im noch neuen Jahr 2022 einiges zu beachten – gerade im Bereich Gebäude und Energie werfen die aktuellen und kommenden Neuerungen zahlreiche Fragen auf. Folglich ist es Zeit, sich den Themen CO2-Steuer und dem Gebäudeenergiegesetz zu widmen, was vor allem für Verwalter unumgänglich ist. Aber auch Eigentümer, die vermieten, oder in deren Wohnungseigentümergemeinschaften Beschlüsse über energetische Sanierungen anstehen, sollten sich jetzt umfassend informieren. Ganz so übersichtlich ist die Lage zu Vorgaben und Förderung nicht, denn mit der Ampel-Regierung wird stetig an Neuerungen gefeilt. Spannend wird es, wie die Kostenübernahme im Einzelnen ausgehandelt wird. Wie attraktiv, komfortabel und kostengünstig eine selbstgenutzte Eigentumswohnung oder ein Renditeobjekt ist, hängt zu einem gewissen Anteil auch an der Wärmeerzeugung oder dem Hitzeschutz.
Inhaltsverzeichnis
Anreize für die energetische Sanierung von Wohneigentum
Nach wie vor wird in zahlreichen Wohnungseigentümergemeinschaften mit fossilen Brennstoffen wie Erdöl oder Erdgas geheizt – schließlich bestehen viele WEGs nicht aus effizienten Neubauten, in denen eine Photovoltaikanlage zum Standard gehört. Steht vielleicht in Kürze beispielsweise der nötige Austausch einer in die Jahre gekommenen Heizanlage an, sollten Eigentümer und Verwalter überlegen, ob nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist, eine Alternative zur klassischen Ölheizung zu finden. Je nach Gebäudeart, Höhe der Erhaltungsrücklage und den Vorlieben der Eigentümer kommen ganz unterschiedliche Heizarten in Betracht.
Da Öl mit 266 Gramm CO2 pro kWh mehr klimaschädliches Gas ausstößt als Erdgas mit 202 Gramm CO2 pro kWh, ist das Heizen mit Öl teurer. Für ein älteres Einfamilienhaus alleine fällt ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von etwa 20.000 kWH Öl (entspricht 5,3 Tonnen CO2) oder Gas (entsprecht 4 Tonnen CO2) an.
Die CO2-Steuer: Wer zahlt was?

Mit dem Inkrafttreten des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, kurz BEHG, zum 1. Januar 2021 hat sich für alle, die mit fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl heizen, etwas Grundlegendes geändert. Die sogenannte CO2-Steuer, welche darauf abzielen soll, die entsprechende Erzeugung der Emissionen zu reduzieren, wurde staatlich festgelegt. Das bedeutet, dass für jede Tonne C02 und für jedes Jahr, unabhängig vom fossilen Energieträger, ein bestimmter Preis vorgegeben ist. Dieser stieg von 25 € pro Tonne CO2 im Jahr 2021 auf 30 € für 2022 und soll bis 2025 schrittweise auf 50 € je Tonne angehoben werden. Umgerechnet auf eine Kilowattstunde Erdgas ergab sich daraus für 2021 ein zusätzlich zu entrichtender Betrag von 0,54 Cent/ (brutto) für jede Kilowattstunde. Signifikante jährliche Zusatzkosten also, die für Mieter sowie Eigentümer Fragen aufwerfen: Wer übernimmt die Kosten? Ursprünglich war eine hälftige Übernahme dieser CO2-Steuer durch die Vermieter angedacht, allerdings wurde dieses Vorhaben im Sommer 2021 verworfen. Aktuell plant die Ampel-Koalition wieder eine Aufsplittung des CO2-Betrags zwischen Mietern und Vermietern. Ab Juni 2022 soll es ein Stufenmodell geben, welches sich nach den Gebäudeenergieklassen richtet.
Neuerungen des Gebäudeenergiegesetzes in 2022

Die Ampelkoalition plant (Stand Januar 2022), das Gebäudeenergiegesetz zu überarbeiten. Dazu gehört unter anderem die Überarbeitung von Gebäudestandards sowie die Förderung effizienter Gebäude mit Ökoheizung.
Aber nicht nur die CO2-Steuer, sondern auch das Gebäudeenergiegesetz (in Inkrafttreten: 1. November 2020) gibt wichtige Rahmenbedingungen für das Wohnen vor. Dies betrifft vor allem Vorgaben für Bestandsgebäude respektive Liegenschaften, die bereits länger bestehen: Es gelten gewisse Austausch- und Nachrüstpflichten, die Eigentümer und Verwalter kennen sollten. Beim Neubau wiederum legt das GEG einen gewissen Anteil an erneuerbaren Energien für das Kühlen oder Heizen fest. Mieter können sich natürlich nicht aussuchen, welche Art des Heizens der Vermieter vorgibt und Verwalter folgen den Entscheidungen respektive Beschlüssen der Eigentümer auf der Eigentümerversammlung.
Zentrale Punkte rund um das Thema GEG und CO2-Steuer
Die Beratung und der Antrag müssen von einem KfW-zugelassenen Energieberater durchgeführt und eingereicht werden, ansonsten verlieren Sie Ihren Anspruch auf staatliche Fördermaßnahmen! Achten Sie bei der Wahl Ihres Energieberaters unbedingt auf die KfW-Zulassung.
- Wer zu 100% Ökostrom bezieht, ist der CO2-Steuer ausgenommen. Dies gilt auch für Biogas, welches von Anbietern bezogen wird, die 100%iges, reines Biogas liefern und nicht nur anteilsmäßig. Je nach Gebäude kann es sich daher für eine WEG lohnen, beispielsweise für den Allgemeinstrom auf 100%igen Ökostrom umzustellen.
- Achtung bei Bioheizöl: Dieses besteht in der Regel nur aus einem Anteil regenerativer Rohstoffe. Somit wird es unterschiedlich, je nach Anteil, besteuert.
- Ab dem Jahr 2026 ist der Einbau neuer Ölkessel nur noch im Ausnahmefall möglich.
- Es gibt verbesserte und neue Förder- und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten bei energetischen Gebäudesanierungen.
- Der Strompreis wird fallen, da ab dem 1. Januar 2023 der Bundeshaushalt die EEG-Umlage finanziert. Unter anderem Wärmepumpen sollen damit attraktiver werden. Für das Jahr 2022 beträgt die Höhe der EEG-Umlage 3,72 Cent/kWh (brutto).
- Förderungen durch die KfW fallen umfangreich aus. Aber Achtung: Der Anspruch auf staatliche Fördermaßnahmen erlischt, wenn Antrag und Beratung nicht von einem KfW-zugelassenen Energieberater durchgeführt werden. Achten Sie daher immer auf die KfW-Zulassung. Ein erfahrener Verwalter wird dies natürlich wissen.
- Bei den Gebäudestandards ist zu beachten, dass der Betrieb neu eingebauten Heizungen ab 2026 auf Basis von mindestens 65 % regenerativer Energien laufen soll.
Solarbeschleunigungspaket: Zahlreiche Einzelmaßnahmen zur Beschleunigung sollen umgesetzt werden, unter anderem in den Bereichen Mieterstrom sowie Solarpflicht für Gewerbeneubauten. Bei Wohnhäusern soll Photovoltaik zukünftig die Regel sein. - Nicht immer muss eine Heizung komplett getauscht werden. Auch Maßnahmen, welche zur Energieeinsparung führen wie beispielsweise der Austausch einer Heizungspumpe oder ein hydraulischer Abgleich werden finanziell vom BAfA gefördert.
Energieausweise: Bitte gut sichtbar!
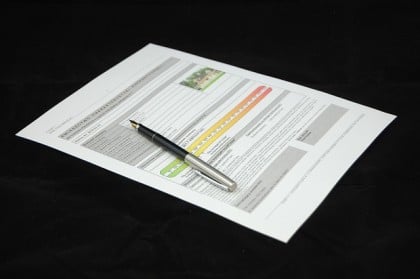
Neu ist auch ein Urteil des Landgerichts Berlin (Az LG Berlin 101 O 15/20) zur Stärkung der Rechte von Kauf- oder Mietinteressenten von Wohnungen. Energieausweise bei Wohnungsbesichtigungen müssen unaufgefordert vorgezeigt oder sichtbar ausgehängt werden. Aber nicht nur das ist vorgegeben, auch inhaltlich hat sich etwas geändert: Wenn ein neuer Energieausweis ausgestellt wird, muss der Wert der CO2-Emmissionen für das Beheizen des Gebäudes angegeben werden. An der Gültigkeit von 10 Jahren ändert sich allerdings nichts. Konkret heißt dies, dass ein Energieausweis aus dem Jahr 2015 nach wie vor gültig ist, da in diesen die Regeln der EnEV von 2009 beachtet wurden, auch wenn dann keine CO2-Werte angegeben sind.
Fazit: Viele Maßnahmen, viele Zuschüsse für Eigentümer
Nach der WEG-Reform ist es wesentlich einfacher geworden, Beschlüsse zu energetischen Sanierungen umzusetzen, und zwar mit einfacher Mehrheit. Bedenken Sie als Eigentümer auch, dass die Eigentümerversammlung jetzt immer beschlussfähig ist. Diese sollten jedoch im Voraus wirklich sehr gründlich und bedacht geplant werden. Ganz wichtig: Ohne Energieberater, und zwar einen von der KfW zugelassenen, verlieren Eigentümer und Verwalter leicht den Überblick, welche Maßnahmen in welchem Umfang finanziell gefördert werden. Auch ist der Zeitpunkt für die Sanierung nicht immer einfach zu wählen, da mit der neuen Regierung stetig weitere finanzielle oder steuerliche Anreize geschaffen werden, von fossilen Energieträgern loszukommen. Gleichzeitig entwickelt sich die Technik immer weiter und Interessant wird auch die Aushandlung, wer für die CO2-Steuer zukünftig aufkommen wird und ob Vermieter künftig die Hälfte übernehmen werden.
Die Sache mit der Finanzierung in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG)

Ein guter Verwalter rät den Eigentümern zu der Ansparung einer Erhaltungsrücklage (früher: Instandhaltungsrücklage), die dem Zustand und Alter des Gebäudes entspricht. Nicht immer wird diesem Rat gefolgt oder es kommen größere, unvorhergesehene Reparaturen auf die Liegenschaft zu. Es kann natürlich auch vorkommen, dass die WEG von einem Verwalter betreut wird, dem eine angemessene Erhaltungsrücklage völlig egal ist. So oder so ist das Thema Finanzierung oft relativ unbeliebt. Hinzu kommt der Umstand, dass trotz Förderung häufig ein größerer Betrag anfällt und Banken ungern Kredite an Wohnungseigentümergemeinschaften vergeben. Bedenken Sie dabei stets auch die Ausfallhaftung im Innenverhältnis. Ist ein Eigentümer zahlungsunfähig, müssen die anderen zahlen – ein Risiko, das für Banken bei der Vergabe eine Rolle spielt. Eine Option, falls in einer WEG die Rücklagen für die Maßnahmen nicht reichen, wäre die Einreichung von Einzelanträgen, bei denen die Eigentümer individuell für die Beträge aufkommen. Wenn diese Einzelanträge gestellt werden, stellt die Bank die Bonität der WEG insgesamt fest.
Über die Autorin
Lisa Bönemann hat über mehrere Jahre hinweg als Eigentümerin die verschiedensten Hausverwaltungen kennengelernt: engagierte und kompetente Verwaltungen sowie leider auch weniger gute, bei denen die Post monatelang auflief. In dieser Zeit hat sie sich intensiv in das Thema Hausverwaltung einarbeiten müssen und festgestellt, dass es im Internet nur wenig Informationen für Wohnungseigentümer gibt. Um dies zu ändern, hat sie das Portal Hausverwaltung-Ratgeber.de gegründet.











